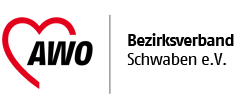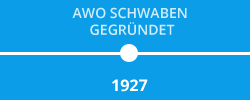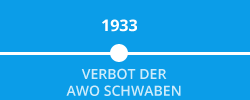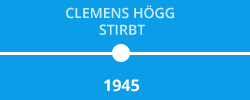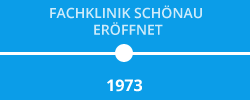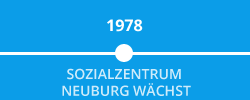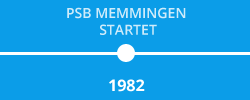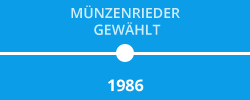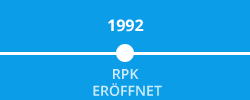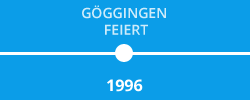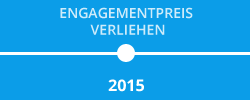Kreisverbände
Zirkel um Magnus Bunk steht für den Neubeginn
Der während des NS-Regimes von Magnus Bunk unterhaltene private Zirkel mit Martha Eder, Christian Großmüller, Franz Xaver Sennefelder und Maria Simon bildete neben Valentin Baur und seiner Frau Luise Stein-Baur, Fritz Eichleiter und Reinhard Stier den Kern für den Wiederbeginn der Arbeiterwohlfahrt sowohl auf Orts- als auch auf Bezirksebene. Im näheren Umkreis wirkten bald auch schon die Stadträte Anny Bittracher, Eduard Herrmann, Josef Hurter und Peter Ott sowie Anny Zach mit. Den Vorstand der Arbeiterwohlfahrt Augsburg bildeten in den Jahren 1946 und 1947 Sennefelder (1. Vorsitzender), Maria Simon (2. Vorsitzende), Reinhard Stier (Kassier) und Martha Eder (Schriftführerin). Als Franz Xaver Sennefelder 1947 zum schwäbischen Bezirksvorsitzenden gewählt wurde, folgte ihm Peter Ott im Amt und war von 1948 bis 1955 Vorsitzender zunächst des Orts- und dann des Kreisverbandes Augsburg-Stadt.
Die Linderung der Not stand im Vordergrund
Die erste Tätigkeit – mit dem vordringlichen Ziel der Linderung der täglichen Not – lässt sich in Augsburg ab Sommer 1946 nachweisen. Von 1946 bis August 1947 wurden rund 900 Personen mit Lebensmitteln, 1423 Kleidungsstücken und 931 Paar Schuhen versorgt und rund 11000 Essensportionen verteilt. Allein bei der Weihnachtsfeier 1946 wurden 500 Kinder und 200 sonstige Bedürftige beschenkt.
Nähstube machte Schule
1947 richtete die Arbeiterwohlfahrt eine Nähstube am Rabenbad 6 ein, in der täglich 15 bis 20 Frauen arbeiten konnten. Die Frauen stellten in diesem Jahr 392 Kleidungsstücke her bzw. besserten sie aus. 1948 kam eine teilweise vom Arbeitsamt geförderte Nähschule – eine der ersten in Augsburg – in den Räumlichkeiten der Geschäftsstelle in der Äußeren Uferstraße 9 dazu. Bis 1951 wurden hier insgesamt 187 Mädchen mit zusammen 3598 Fördertagen unterrichtet.
AWO erhielt enteignetes Erholungsheim Mickhausen zurück
Die Arbeiterwohlfahrt erhielt ihr Kindererholungsheim in Mickhausen zurück, das 1930 von der Augsburger Arbeiterwohlfahrt mühevoll eingerichtet und von den Nationalsozialisten 1933 enteignet worden war. Von Juli 1946 bis zum Saisonende im September 1948 war das Haus wieder als Erholungsheim verfügbar. Pro Jahr waren dort rund 240 Augsburger Kinder und 240 Flüchtlingskinder zur Erholung. Letztere kamen auch durch Vermittlung der Ortsvereine bzw. Kreisverbände Friedberg, Füssen, Kempten (Allgäu) und Schwabmünchen nach Mickhausen. Weiteren 20 besonders unterernährten Augsburger Kindern ermöglichte der Ortsverein eine Regeneration im Naturfreundehaus in Blaichach.
Als Schloss Hainhofen zum Seniorenheim wurde
Die Augsburger Arbeiterwohlfahrt richtete 1949 im Kindererholungsheim Mickhausen ein Altenheim ein. Die etwa 30 Bewohner waren zumeist Heimatvertriebene und Flüchtlinge mit einem Durchschnittsalter von 70 Jahren. 1953 beendete der Kreisverband die als Notbehelf gedachte Unterbringung von Senioren im Kindererholungsheim Mickhausen. Ein weiteres Altenheim eröffnete die Augsburger Arbeiterwohlfahrt in einem Trakt des Schlosses in Hainhofen, das seit 1.11.1949 der Flüchtlingsverwaltung unterstand. In ihm lebten rund 90 Personen, wiederum zumeist Heimatvertriebene und Flüchtlinge. Dieses immer wieder von Pflegepersonalmangel geplagte Heim wurde 1964 geschlossen.
1948: Göggingen gründet eigene Sektion

Am 12. März 1946 erklärten August und Thusnelda Ulrich, Hans Unger und Georg Mack ihre Bereitschaft, künftig in Göggingen die Arbeit der Arbeiterwohlfahrt zu aktivieren. Ein Ortsverein wurde aber noch nicht gegründet. Jedoch wurde unter der Ägide von Thusnelda Ulrich im Sommer 1946 eine Nähstube der Arbeiterwohlfahrt errichtet. Ab September 1946 organisierte die Arbeiterwohlfahrt in der Jahn-Schule eine Speisung für täglich bis zu 120 Personen (sog. Flüchtlingsküche). Auch an der Schulspeisung beteiligte sich die Arbeiterwohlfahrt.
1951: Gründung geglückt, Aufbau abgeschlossen
Über eine einheitliche und flächendeckende Gliederung der Organisation versuchte die Arbeiterwohlfahrt, ihre Aufgaben und Ziele noch besser anzugehen. Entsprechend der staatlichen Kreiseinteilung wurden Kreisverbände geschaffen. Mit der Gründung des Kreisverbandes Augsburg-Stadt für den Stadtkreis Augsburg und seiner Eintragung als Verein war am 22. September 1951 der organisatorische Aufbau abgeschlossen. Die Etablierung eigener Ortsvereine im Stadtgebiet erfolgte erst ab Ende der fünfziger Jahre.
Arbeiter aus Fabriksiedlung gründen Ortsverein Gersthofen
Am 1. Februar 1948 gründeten auf Initiative des 2. Bürgermeisters Hans Sturm 22 Personen, fast nur Arbeiter aus der Fabriksiedlung, den Ortsverein Gersthofen der Arbeiterwohlfahrt. Zum Ersten Ortsvereinsvorsitzenden wählten sie Alfons Pfiffner. Die Gründung erfolgte, obwohl die Arbeiterwohlfahrt in Gersthofen als Verband noch nahezu unbekannt war und nach Verbot und Krieg kaum Anreize bot. Dementsprechend fand die Organisation nur eine langsame Verbreitung nach Süden ins Gersthofer Ortszentrum.
Neusäß: Götz wird erster Vorsitzender
Der Ortsverein Neusäß wurde am 11. November 1949 im Restaurant Lohwald unter Mitwirkung von Frau Maria Simon ins Leben gerufen; die offizielle Gründungsversammlung war am 1. Dezember 1949. Gründungsmitglieder waren: Matthias Bihler, Anna und Edmund Ertel, Clement Fritzcher, Wenzel Gössl, Ulrich Götz, Lorenz Heider, Ludwig Merbeth, Alfred Schellemann, Georg Spatz und Willy Tremper. Der Ortsverein umfasste auch die Orte Ottmarshausen und Hammel. Zum Ortsvereinsvorsitzenden wurde Ulrich Götz gewählt.
Gföllner wird erster Vorsitzender
1947 wurde der Ortsverein Aichach im damaligen "Pfallerwirt" gegründet. Gründungsmitglieder waren unter anderem Franz Gföllner, Franz Kukol, Peter Linzenkirchner, Sauter, Schönwälder, Weiß und Wurfbaum. Zum Ersten Vorsitzenden wurde Franz Gföllner gewählt. Er führte auch den 1948 eingerichteten Kreisverband Aichach bis 1953.
Die Aichacher Arbeiterwohlfahrt half die damalige Not von Flüchtlingen, Vertriebenen, Ausgebombten, Evakuierten, Heimkehrern und elternlosen Kindern nach Kräften zu lindern. Eine der ersten Leistungen war dabei die Einrichtung einer Schulspeisung, denn “die Kinder sollten was Gescheites zum Essen bekommen“.